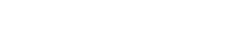Forscher der Osaka Metropolitan University haben eine vielversprechende neue Methode zur Behandlung von Wirbelsäulenfrakturen entwickelt, bei der Stammzellen aus Fettgewebe, also Körperfett, verwendet werden. In Tierversuchen konnte mit dieser Behandlung erfolgreich Wirbelsäulenverletzungen bei Ratten geheilt werden, die osteoporosebedingte Frakturen beim Menschen nachahmen. Da diese Zellen selbst bei älteren Erwachsenen leicht zu entnehmen sind und den Körper nur minimal belasten, könnte diese Technik eine schonende, nicht-invasive Alternative zur Behandlung von Knochenerkrankungen darstellen.
Lähmende Osteoporose
Jährlich werden sage und schreibe 8,9 Millionen Frakturen durch Osteoporose verursacht, das entspricht einer Fraktur alle drei Sekunden! Die alternde Bevölkerung ist aufgrund ihrer Gebrechlichkeit am anfälligsten für primäre Osteoporose und benötigt oft eine langfristige Therapie und Unterstützung. Die Fortschritte im Gesundheitswesen und der damit einhergehende Anstieg der alternden Bevölkerung belasten die verfügbaren Ressourcen und unterstreichen die Notwendigkeit wirksamer Therapien gegen Osteoporose. Osteoporose schwächt die Knochen, macht sie brüchig und erhöht die Bruchgefahr.
Osteoporose in der Menopause entsteht vor allem durch den Rückgang des Hormons Östrogen, das zuvor eine schützende Wirkung auf die Knochen hatte. Während der fruchtbaren Jahre unterstützt Östrogen sowohl den Aufbau als auch den Erhalt der Knochenmasse, indem es den Abbau durch Osteoklasten hemmt. Mit Beginn der Menopause sinkt der Östrogenspiegel stark ab, wodurch der Knochenabbau schneller erfolgt als der Aufbau, was die Knochen dünner, poröser und anfälliger für Brüche macht. Besonders betroffen sind dabei die Wirbelkörper, das Handgelenk und der Oberschenkelhals, was das Risiko für Schmerzen, Wirbelkörperfrakturen oder Stürze deutlich erhöht. Auch Männer sind mit zunehmendem Alter betroffen, obgleich der Hormonrückgang beim starken Geschlecht eher schleichend erfolgt.
Mit der Zeit sinkt der Testosteronspiegel, und da Testosteron direkt und indirekt über Östrogenbildung den Knochenaufbau unterstützt, kommt es allmählich zu einer Abnahme der Knochenmasse. Dieser Prozess führt dazu, dass die Knochen brüchiger werden und das Risiko für Frakturen, insbesondere der Wirbelkörper, Hüfte und Handgelenke, steigt. Männer bemerken Osteoporose oft erst, wenn bereits ein Bruch auftritt, da die Erkrankung zunächst keine Schmerzen verursacht. Faktoren, die das Risiko zusätzlich erhöhen, sind Untergewicht, Bewegungsmangel, Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum, Mangel an Kalzium und Vitamin D sowie bestimmte Medikamente wie Kortison oder Antikonvulsiva. Auch chronische Erkrankungen, etwa Diabetes oder chronische Entzündungen, können die Knochen schwächen.
Wie aus Fett gewonnene Stammzellen beim Wiederaufbau von Knochen helfen
Angesichts der zunehmenden Alterung der japanischen Bevölkerung wird die Zahl der Betroffenen voraussichtlich 15 Millionen überschreiten. Unter den verschiedenen Arten von Frakturen, die durch Osteoporose verursacht werden, sind Kompressionsfrakturen der Wirbelsäule, sogenannte osteoporotische Wirbelkörperfrakturen, am häufigsten. Diese Verletzungen können zu langfristigen Behinderungen führen und die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen, was die Notwendigkeit sicherer und wirksamerer Behandlungen unterstreicht. Aus Fettgewebe gewonnene Stammzellen (ADSCs) zeigen ein großes Potenzial für die Reparatur von Knochenschäden. Diese multipotenten Zellen können sich zu verschiedenen Gewebetypen entwickeln, darunter auch Knochen. Wenn ADSCs zu dreidimensionalen kugelförmigen Gruppen, sogenannten Sphäroiden, kultiviert werden, erhöht sich ihre Fähigkeit, die Gewebereparatur zu fördern. Durch die Vor-Differenzierung dieser Sphäroide zu knochenbildenden Zellen wird ihre Wirksamkeit bei der Stimulierung der Knochenregeneration weiter verbessert.
Unter der Leitung von Yuta Sawada, Student an der Graduate School of Medicine, und Dr. Shinji Takahashi verwendete das Forschungsteam aus Osaka ADSCs, um knochendifferenzierte Sphäroide zu erzeugen, und kombinierte diese mit β-Tricalciumphosphat, einem Material, das häufig bei der Knochenrekonstruktion verwendet wird. Die Mischung wurde bei Ratten mit Wirbelsäulenfrakturen angewendet, was zu einer signifikanten Verbesserung der Knochenheilung und -festigkeit führte.
Die Forscher beobachteten außerdem, dass die für die Knochenbildung und -regeneration verantwortlichen Gene nach der Behandlung aktiver wurden, was darauf hindeutet, dass dieser Ansatz die natürlichen Heilungsprozesse des Körpers stimuliert. „Diese Studie hat das Potenzial von knochendifferenzierten Sphäroiden unter Verwendung von ADSCs für die Entwicklung neuer Behandlungen für Wirbelsäulenfrakturen aufgezeigt“, sagte Sawada. „Da die Zellen aus Fett gewonnen werden, ist die Belastung für den Körper gering, was die Sicherheit der Patienten gewährleistet.“ Dr. Takahashi fügte hinzu: „Mit dieser einfachen und wirksamen Methode lassen sich selbst schwierige Frakturen behandeln und die Heilung beschleunigen. Es ist zu erwarten, dass diese Technik zu einer neuen Behandlungsmethode wird, die dazu beiträgt, das gesunde Leben der Patienten zu verlängern.“
Vielversprechende Aussichten für zukünftige Behandlungen
Doch es gibt noch andere mögliche Wege. Frühere Forschungen aus Japan haben einen aussichtsreichen Wirkstoff für die Behandlung von Osteoporose identifiziert. Tatsächlich hat die Induktion der Parathormon (PTH)-Signalübertragung unter Verwendung des von PTH abgeleiteten Peptids Teriparatid bei Patienten mit Osteoporose eine starke knochenfördernde Wirkung gezeigt. Diese Wirkung wird durch die Osteogenese vermittelt, den Prozess der Knochenbildung, an dem die Differenzierung und Reifung von knochenbildenden Zellen, den sogenannten Osteoblasten, beteiligt ist. Die PTH-Induktion ist jedoch auch mit der Differenzierung von Makrophagen zu Osteoklasten verbunden, bei denen es sich um spezialisierte Zellen handelt, die für den Knochenabbau verantwortlich sind. Obwohl der Knochenumbau durch Osteoblasten und Osteoklasten für die Erhaltung der Skelettgesundheit von entscheidender Bedeutung ist, kann die PTH-induzierte Osteoklastendifferenzierung die Wirksamkeit der Behandlung bei Patienten mit Osteoporose verringern. Die genauen molekularen Mechanismen, die der doppelten Wirkung der PTH-Signalübertragung beim Knochenumbau zugrunde liegen, sind jedoch noch nicht vollständig geklärt.

Um diese Lücke zu schließen, führten Professor Tadayoshi Hayata und Frau Chisato Sampei von der Tokyo University of Science zusammen mit ihren Kollegen eine Reihe von Experimenten durch, um medikamentös behandelbare Zielgene zu identifizieren, die dem PTH-Signalweg in Osteoblasten nachgeschaltet sind. Der korrespondierende Autor, Prof. Hayata, erläutert die Gründe für ihre Studie, die im Journal of Cellular Physiology veröffentlicht wurde: „In Japan leiden schätzungsweise 12,8 Millionen Menschen, also jeder Zehnte, an Osteoporose, was ihre Lebensqualität erheblich beeinträchtigen kann. Teriparatid wird als Medikament zur Förderung der Knochenbildung eingestuft, fördert jedoch auch die Knochenresorption, was die Knochenbildung einschränken kann. Der volle Umfang seiner pharmakologischen Wirkung ist jedoch noch unbekannt.“
Neues Zielmolekül entdeckt, das die Knochenbildung unterdrückt
Die Forscher behandelten kultivierte Osteoblastenzellen von Mäusen und Mäuse mit Teriparatid. Anschließend bewerteten sie mithilfe einer fortschrittlichen RNA-Sequenzierungsanalyse die durch PTH induzierten Veränderungen der Genexpression sowohl in den kultivierten Zellen als auch in den aus den Femora der behandelten Tiere isolierten Knochenzellen. Unter mehreren hochregulierten Genen identifizierten sie ein neues PTH-induziertes Gen – „Gprc5a“, das für einen Orphan-G-Protein-gekoppelten Rezeptor kodiert, der zuvor als therapeutisches Ziel untersucht worden war. Seine genaue Rolle bei der Osteoblastendifferenzierung war jedoch noch nicht vollständig geklärt.
Es ist bekannt, dass die PTH-Induktion die Signalewege des zyklischen Adenosinmonophosphats (cAMP) und der Proteinkinase C (PKC) aktiviert. Interessanterweise fand das Team heraus, dass neben der PTH-Induktion auch die Aktivierung von cAMP und PKC zu einer Überexpression von Gprc5a führte, wenn auch in geringerem Maße, was die mögliche Beteiligung anderer molekularer Signalwege unterstreicht. Bemerkenswert ist, dass die Hochregulation von Gprc5a bei Hemmung der Transkription unterdrückt wurde, bei Unterdrückung der Proteinsynthese jedoch unbeeinträchtigt blieb, was darauf hindeutet, dass Gprc5a frühzeitig als Reaktion auf PTH-Signale transkribiert werden könnte und als direktes Zielgen dient. Darüber hinaus untersuchten die Forscher die Auswirkungen einer Herunterregulierung von Gprc5a auf die Proliferation und Differenzierung von Osteoblasten. Bemerkenswert ist, dass die PTH-Induktion allein keinen Einfluss auf die Zellproliferation hatte, während die Herunterregulierung von Gprc5a zu einer erhöhten Expression von Genen, die mit dem Zellzyklus in Zusammenhang stehen, und von Markern für die Osteoblastendifferenzierung führte. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Gprc5a die Proliferation und Differenzierung von Osteoblasten unterdrückt.
Bei der eingehenden Untersuchung der molekularen Mechanismen, die den Wirkungen von Gprc5a bei der PTH-induzierten Osteogenese zugrunde liegen, identifizierten die Forscher die Activin-Rezeptor-ähnliche Kinase 3 (ALK3) – einen Rezeptor des Signalwegs des knochenmorphogenetischen Proteins (BMP) – als Interaktionspartner von Gprc5a. Entsprechend ihrer Vermutung führte die Überexpression von Gprc5a tatsächlich zu einer Unterdrückung der BMP-Signalübertragung über Rezeptoren wie ALK3. Insgesamt zeigen diese Ergebnisse, dass Gprc5a – ein neuartiges induzierbares Zielgen von PTH – die Proliferation und Differenzierung von Osteoblasten negativ reguliert, indem es die BMP-Signalübertragung teilweise unterdrückt. Gprc5a kann daher als neuartiges therapeutisches Ziel bei der Entwicklung von Behandlungen gegen Osteoporose verfolgt werden. Die Studie beleuchtet den komplexen Prozess des Knochenumbaus und erklärt die knochenfördernden und knochenresorbierenden Wirkungen der PTH-Signalübertragung. „Unsere Studie zeigt, dass Gprc5a als negativer Rückkopplungsfaktor für die knochenbildende Wirkung von Teriparatid fungieren könnte. Die Unterdrückung der Gprc5a-Funktion könnte daher die Wirksamkeit von Teriparatid bei Patienten erhöhen, die nicht auf die Behandlung ansprechen. Wir hoffen, dass unsere Forschung in Zukunft zu einer verbesserten Lebensqualität und einer gesunden Langlebigkeit für Menschen mit Osteoporose führen wird“, schließt Prof. Hayata.
Diese Erkenntnisse sollen den Weg für die Entwicklung wirksamer Therapien ebnen, die das Leben von Menschen mit Osteoporose verbessern können.
Was der Einzelne tun kann, um sein Osteoporose-Risiko zu minimieren

Um das Risiko für Osteoporose aktiv zu senken, kann man schon im Alltag einiges tun, ohne sofort auf Medikamente angewiesen zu sein. Entscheidend ist, den Knochenstoffwechsel zu unterstützen, die Knochendichte zu erhalten und Stürze zu vermeiden. Eine der wichtigsten Maßnahmen ist Bewegung. Krafttraining, Gewicht tragende Aktivitäten wie Gehen, Treppensteigen oder leichtes Joggen sowie Balance-Übungen. Diese stärken nicht nur die Muskeln, sondern auch die Knochen und reduzieren gleichzeitig das Sturzrisiko. Regelmäßige körperliche Aktivität sollte möglichst täglich in den Alltag integriert werden.
Auch die Ernährung spielt eine zentrale Rolle. Eine ausreichende Zufuhr von Kalzium und Vitamin D ist entscheidend, da Kalzium den Knochenaufbau unterstützt und Vitamin D die Aufnahme von Kalzium im Darm erleichtert. Milchprodukte, grünes Blattgemüse, Nüsse und fetter Seefisch liefern wichtige Bausteine. Zusätzlich ist es sinnvoll, auf eine proteinreiche Ernährung zu achten, denn Eiweiß ist für die Knochensubstanz und die Muskelkraft wichtig. Ein gesunder Lebensstil trägt ebenfalls erheblich bei. Rauchen und übermäßiger Alkoholkonsum beschleunigen den Knochenabbau und sollten möglichst vermieden werden. Auch das Körpergewicht spielt eine Rolle: Untergewichtige Menschen haben ein höheres Risiko, daher ist ein normales bis leichtes Übergewicht vorteilhaft für die Knochengesundheit.
Darüber hinaus lohnt es sich, Stürze im Alltag zu vermeiden, zum Beispiel durch gute Beleuchtung, rutschfeste Unterlagen und festes Schuhwerk. Regelmäßige Kontrolluntersuchungen wie der DEXA-Scan können helfen, Veränderungen der Knochendichte früh zu erkennen, sodass gezielt Maßnahmen oder Therapien ergriffen werden können. Mit dieser Kombination aus Bewegung, Ernährung, gesundem Lebensstil und Prävention lässt sich das Osteoporoserisiko deutlich senken.