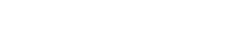Ein internationales Forscherteam hat eine neue Schwachstelle in Prostatakrebszellen entdeckt, die zu wirksameren Behandlungsmethoden für eine der häufigsten Krebsarten bei Männern führen könnte. Die Studie, die in den Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) veröffentlicht wurde, wurde von Wissenschaftlern der Flinders University in Australien und der South China University of Technology geleitet.
Prostatakrebs zählt zu den häufigsten Krebserkrankungen des Mannes
Behandlungsmöglichkeiten
Zu den gängigen Therapieformen zählen Operation (Entfernung der Prostata), Strahlentherapie, Hormon- und Chemotherapie. Die aktuellen Forschungen heben zwei Enzyme hervor, PDIA1 und PDIA5, die eine Schlüsselrolle beim Wachstum, Überleben und Widerstand gegen bestehende Behandlungen von Prostatakrebszellen spielen. Den Experten zufolge wirken PDIA1 und PDIA5 wie molekulare Bodyguards für den Androgenrezeptor (AR), ein Protein, das das Wachstum von Prostatakrebs antreibt. Wenn diese Enzyme blockiert werden, verliert der AR seine Stabilität und zerfällt, wodurch Krebszellen absterben und Tumore sowohl in Laborkulturen als auch in Tiermodellen schrumpfen. Das Team entdeckte außerdem, dass die Kombination von Medikamenten, die PDIA1 und PDIA5 hemmen, mit Enzalutamid, einem Standardmedikament gegen Prostatakrebs, die Behandlung deutlich wirksamer machte.„Wir haben einen bisher unbekannten Mechanismus entdeckt, mit dem Prostatakrebszellen den Androgenrezeptor schützen, der ein wichtiger Treiber der Krankheit ist“, erklärt der leitende Autor Professor Luke Selth, Leiter der Prostatakrebsforschung und Co-Direktor des Cancer Impact-Programms des Flinders Health and Medical Research Institute. „Indem wir diese Enzyme ins Visier nehmen, können wir den AR destabilisieren und Tumore anfälliger für bestehende Therapien wie Enzalutamid machen.“
Eine vielversprechende Kombinationstherapie
Der Hauptautor Professor Jianling Xie, der die Forschung an der Flinders University begann, sagte, dass die Kombinationstherapie sowohl bei Tumorproben von Patienten als auch bei Mausmodellen gut funktionierte und ein großes Potenzial für den klinischen Einsatz zeigte. „Dies ist ein spannender Schritt nach vorne“, sagt Dr. Xie, der jetzt an der South China University of Technology tätig ist. „Unsere Ergebnisse zeigen, dass PDIA1 und PDIA5 nicht nur das Krebswachstum unterstützen, sondern auch vielversprechende Ziele für neue Behandlungen sind, die zusammen mit bestehenden Medikamenten wirken könnten.“
Die Studie ergab auch, dass PDIA1 und PDIA5 mehr tun, als nur den AR zu schützen. Sie helfen den Krebszellen, Stress zu bewältigen und ihre Energieproduktionssysteme aufrechtzuerhalten. Wenn die Enzyme blockiert werden, werden die Mitochondrien – die Kraftwerke der Zellen – beschädigt, was zu oxidativem Stress führt, der die Krebszellen weiter schwächt. „Diese doppelte Wirkung, die sowohl den AR als auch die Energieversorgung des Krebses trifft, macht diese Enzyme zu besonders attraktiven Zielen. Es ist, als würde man gleichzeitig den Treibstoff und den Motor abschalten.
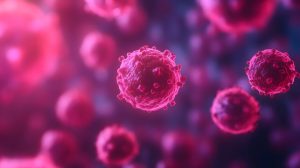
Professor Selth merkt an, dass die derzeitigen PDIA1- und PDIA5-Inhibitoren zwar vielversprechend sind, aber für den Einsatz bei Patienten noch weiterentwickelt werden müssen. Einige der bestehenden Wirkstoffe können gesunde Zellen beeinträchtigen, daher werden sich künftige Studien auf die Entwicklung sicherer und selektiverer Versionen konzentrieren. Prostatakrebs ist weltweit die zweithäufigste Krebsart bei Männern. Obwohl Behandlungen wie Hormontherapie und AR-gerichtete Medikamente die Überlebensraten erheblich verbessert haben, bleibt die Resistenz gegen diese Therapien eine große Herausforderung. Diese neue Entdeckung könnte dazu beitragen, diese Resistenz zu überwinden und die Behandlungsmöglichkeiten für Männer mit fortgeschrittenem Prostatakrebs zu verbessern.
Eine gezielte Medikamentenkombination bremst das Fortschreiten von Prostatakrebs, und läutet eine neue Ära der personalisierten Behandlung ein
Eine groß angelegte internationale Studie unter der Leitung von Forschern der UCL hat kürzlich ergeben, dass die Kombination zweier Krebsmedikamente das Fortschreiten einer schweren und oft tödlichen Form von Prostatakrebs bei Männern mit bestimmten genetischen Mutationen erheblich verlangsamen könnte. Die in Nature Medicine veröffentlichte Phase-III-Studie AMPLITUDE untersuchte, ob die Zugabe von Niraparib, einer als PARP-Inhibitor bekannten zielgerichteten Krebstherapie, die Wirksamkeit der derzeitigen Standardbehandlung mit Abirateronacetat und Prednison (AAP) verbessern könnte.
Die Studie konzentrierte sich auf Männer mit fortgeschrittenem Prostatakrebs, der sich auf andere Körperteile ausgebreitet hatte und die zum ersten Mal eine Behandlung begannen. Alle Teilnehmer wiesen Mutationen in Genen auf, die an der homologen Rekombinationsreparatur (HRR) beteiligt sind, einem wichtigen System, das bei der Reparatur beschädigter DNA hilft. Wenn diese DNA-Reparaturgene nicht richtig funktionieren, können sich Krebszellen schneller vermehren und ausbreiten. Etwa jeder vierte Mann mit fortgeschrittenem Prostatakrebs in diesem Stadium weist Mutationen in HRR-bezogenen Genen auf, darunter BRCA1, BRCA2, CHEK2 und PALB2.
Die Studie und ihre Ergebnisse
Derzeit ist die Standardbehandlung für fortgeschrittenen Prostatakrebs AAP (oder ähnliche Medikamente). Etwa jeder fünfte Patient erhält zusätzlich eine Chemotherapie mit Docetaxel. Patienten mit HRR-Genmutationen erleben jedoch in der Regel ein schnelleres Fortschreiten der Erkrankung und eine kürzere Überlebenszeit unter der Standardbehandlung. An der AMPLITUDE-Studie unter der Leitung von Professor Gerhardt Attard vom UCL Cancer Institute nahmen 696 Männer aus 32 Ländern mit einem Durchschnittsalter von 68 Jahren teil. Die Hälfte erhielt die Kombination aus Niraparib und AAP, während die andere Hälfte die Standard-AAP-Behandlung mit einem Placebo erhielt. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer (55,6 %) wiesen Mutationen in BRCA1 oder BRCA2 auf. Die Studie war doppelblind, d. h. weder die Patienten noch ihre Ärzte wussten, wer die aktive Behandlung erhielt. Nach einer medianen Nachbeobachtungszeit von etwas mehr als zweieinhalb Jahren (30,8 Monate) stellten die Forscher bemerkenswerte Vorteile der Wirkstoffkombination fest:
-
 Geringeres Progressionsrisiko: Niraparib senkte das Risiko für Krebswachstum bei allen Teilnehmern um 37 % und bei denjenigen mit BRCA1- oder BRCA2-Mutationen um 48 %.
Geringeres Progressionsrisiko: Niraparib senkte das Risiko für Krebswachstum bei allen Teilnehmern um 37 % und bei denjenigen mit BRCA1- oder BRCA2-Mutationen um 48 %.- Langsameres Fortschreiten der Symptome: Die Zeit bis zum Fortschreiten der Symptome war bei denjenigen, die Niraparib erhielten, etwa doppelt so lang. Nur 16 % dieser Patienten zeigten ein signifikantes Fortschreiten der Symptome, verglichen mit 34 % in der Placebo-Gruppe.
- Möglicher Überlebensvorteil: In der Niraparib-Gruppe zeigte sich ein Trend zu einer verbesserten Gesamtüberlebensrate, allerdings ist eine längere Nachbeobachtungszeit erforderlich, um zu bestätigen, ob sich die Lebenserwartung verlängert.
Expertenmeinung
Professor Attard sagte: „ Obwohl die derzeitigen Standardbehandlungen für die Mehrheit der Patienten mit fortgeschrittenem Prostatakrebs sehr wirksam sind, hat ein kleiner, aber sehr bedeutender Anteil der Patienten nur einen begrenzten Nutzen davon. Wir wissen heute, dass Prostatakrebs mit Veränderungen in den HRR-Genen eine bedeutende Gruppe von Patienten ausmacht, bei denen die Krankheit schnell wieder auftritt und einen aggressiven Verlauf nimmt. Durch die Kombination mit Niraparib können wir das Wiederauftreten des Krebses verzögern und hoffentlich die Lebenserwartung deutlich verlängern. Diese Ergebnisse sind bemerkenswert, da sie eine umfassende Genomuntersuchung bei der Diagnose und den Einsatz einer gezielten Behandlung für Patienten unterstützen, die den größten Nutzen daraus ziehen können. Bei Krebserkrankungen mit einer Mutation in einem der in Frage kommenden HRR-Gene, für die Niraparib zugelassen ist, sollte ein Arzt eine Abwägung zwischen den Risiken von Nebenwirkungen und dem klaren Nutzen einer Verzögerung des Krankheitswachstums und einer Verschlechterung der Symptome in Betracht ziehen.“
Die Behandlung wurde im Allgemeinen gut vertragen, jedoch traten in der Niraparib-Gruppe häufiger Nebenwirkungen auf. Bei Niraparib wurden signifikant mehr Fälle von Anämie und Bluthochdruck gemeldet, und 25 % der Patienten benötigten Bluttransfusionen. Auch die behandlungsbedingten Todesfälle waren in der Niraparib-Gruppe höher (14 gegenüber 7), obwohl die Gesamtabbrecherquote niedrig blieb. Die Autoren der Studie merken an, dass die Ergebnisse zwar vielversprechend sind, jedoch weitere Untersuchungen erforderlich sind, um die langfristigen Überlebensvorteile zu bestätigen und die Auswirkungen neuerer Bildgebungsverfahren und umfassenderer Gentests zu untersuchen.